Die Probleme des Geradeausempfängers
Die ersten Rundfunkempfänger verarbeiteten das Signal sehr direkt und geradlinig. Der Eingangsschwingkreis filterte so gut es ging die Frequenz des gewünschten Senders heraus und unterdrückte andere Sender. Um die Empfindlichkeit zu erhöhen, folgte dann eventuell ein Hochfrequenzverstärker. Anschließend wurde das Signal demoduliert und die Niederfrequenz nochmals verstärkt.
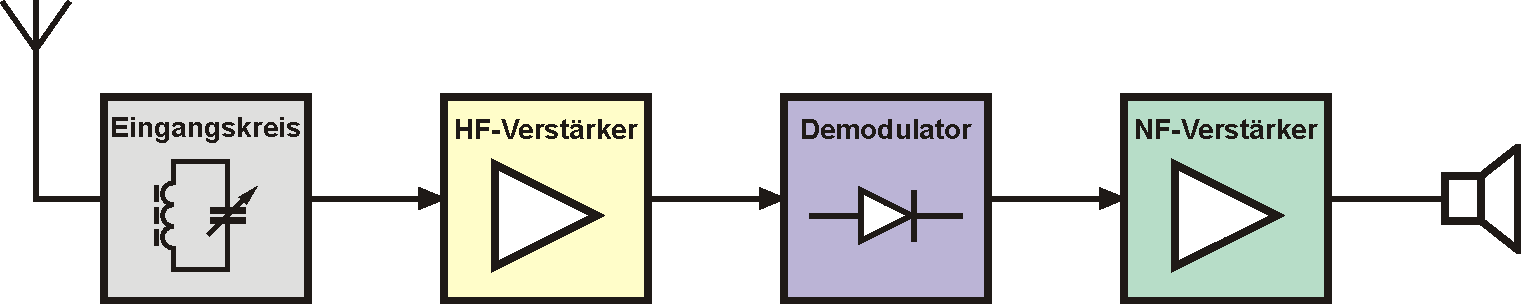
Mit steigender Senderdichte reichte die Trennschärfe des Eingangskreises nicht mehr aus. Um mit zusätzlichen Filtern die Trennschärfe zu erhöhen, mussten diese Schwingkreise exakt im Gleichlauf auf dieselbe Frequenz abgestimmt werden, wodurch die Zahl begrenzt war. Bei hohen Empfangsfrequenzen sind spezielle Bauelemente nötig, um im HF-Verstärker noch eine ausreichende Verstärkung zu erreichen. Das verstärkte HF-Signal konnte auf die Antenne zurückwirken, wodurch eine Rückkopplung entsteht. Entsprechende Abschirmungen waren nötig. Für leistungsstarke und trennscharfe Empfänger mussten andere Empfangsprinzipien her.
Der Superheterodynempfänger
Beim Superhet wird die Empfangsfrequenz zunächst in eine niedrigere feste Frequenz umgewandelt, die sogenannte Zwischenfrequenz. Dazu wird das Signal mit der Frequenz eines Oszillators gemischt. Dessen Frequenz liegt um die Zwischenfrequenz höher, die sich als Differenz beider Frequenzen ergibt.
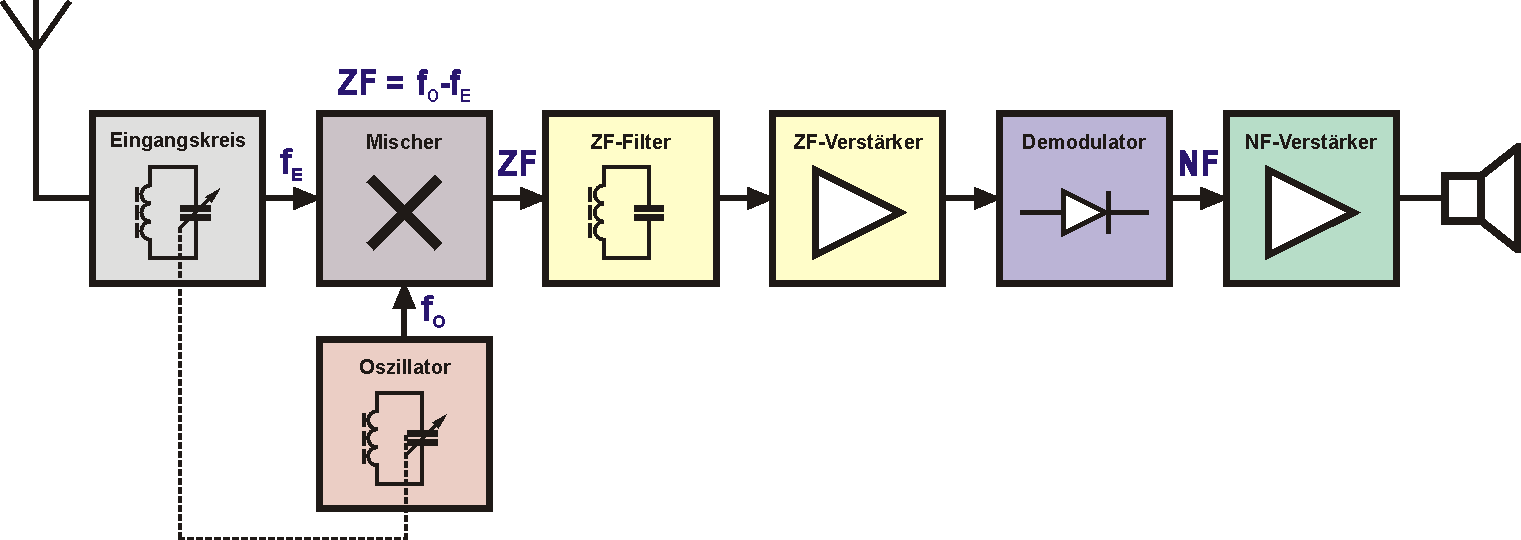
Bei der niedrigeren Zwischenfrequenz ist die Trennschärfe von Schwingkreisen besser. Außerdem kann jetzt die Zahl der Kreise weiter erhöht werden, da diese ja nur einmalig auf eine feste Frequenz abgestimmt werden müssen. Im Zwischenfrequenzverstärker sind die Anforderungen an die Bauelemente geringer und man erreicht höhere Verstärkungen als bei der höheren Senderfrequenz. Prinzipiell ist jede Zwischenfrequenz möglich. Man hat sich aber allgemein auf bestimmte Frequenzen geeinigt. Beim AM-Lang- und Mittelwellenrundfunk verwendet man 455-460 kHz, beim UKW-Rundfunk 10,7 MHz.
Sehen wir uns die Funktion an einem Beispiel an. Angenommen, es soll ein MW-Sender auf 800 kHz empfangen werden. Der Oszillator schwingt dann auf 1255 kHz. Der Zwischenfrequenzverstärker übernimmt die Selektion und Verstärkung bei 455 kHz. Mit einem Sender auf zum Beispiel 1000 kHz würde eine Differenzfrequenz von nur 255 kHz entstehen, die vom ZF-Verstärker sicher unterdrückt wird. Man stimmt also mit dem Oszillator auf den gewünschten Sender ab.
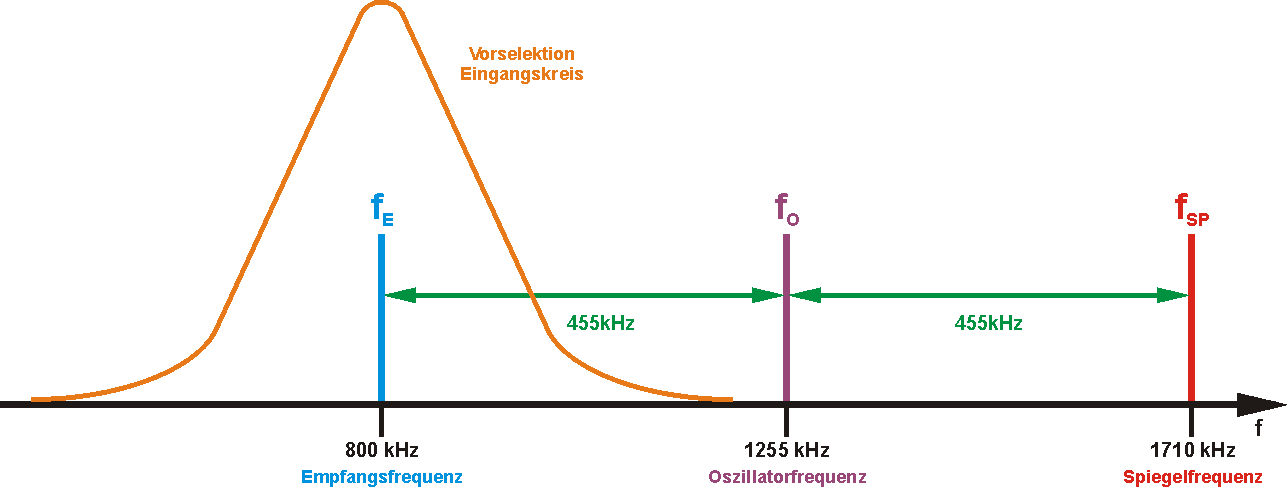
Wozu braucht man dann noch den Eingangskreis? Die Zwischenfrequenz entsteht im Mischer nicht nur mit den 800 kHz. Auch ein Sender, der 455 kHz über der Oszillatorfrequenz liegt, würde eine Mischfrequenz von 455 kHz erzeugen und auch verstärkt werden. Diese Frequenz nennt man Spiegelfrequenz und in unserem Fall liegt die bei 1710 kHz. Der Eingangskreis übernimmt die Vorselektion und muss diese Spiegelfrequenz sicher unterdrücken. Er wird zusammen mit dem Oszillator abgestimmt. Wählt man die Zwischenfrequenz zu niedrig, liegen Empfangs- und Spiegelfrequenz zu dicht beieinander.
Für eine gute Spiegelselektion bei höheren Empfangsfrequenzen benutzte man auch sogenannte Mehrfachsuper. Zunächst wählt man die Zwischenfrequenz etwas höher, damit der Abstand zur Spiegelfrequenz größer ist. Danach kann man das Signal durch erneute Mischung mit einem fest eingestellten Oszillator auf eine niedrigere Zwischenfrequenz umsetzen. Der zweite ZF-Verstärker erreicht dann eine bessere Verstärkung und Trennschärfe.
Der Direktmischempfänger
Eine Sonderform des Überlagerungsempfängers ist der Direktmischer, bei dem in der Mischstufe gleich das NF-Signal erzeugt wird. ZF-Verstärker und Demodulator entfallen, was den Aufwand erheblich verringert. Die Verstärkung und die Selektion der Sender übernimmt der NF-Verstärker.
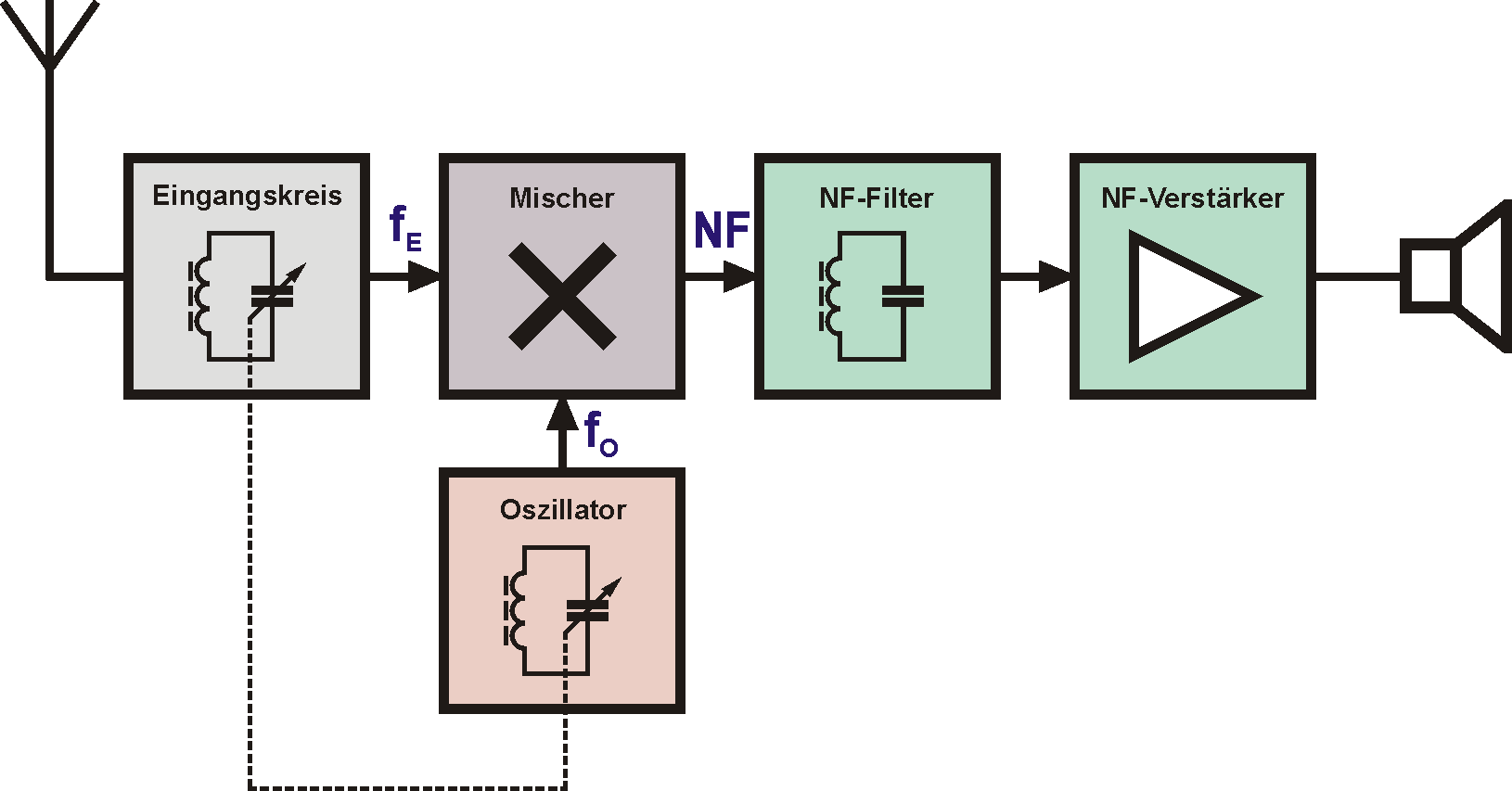
Im Gegensatz zum Superhet ist der Oszillator genau auf die Empfangsfrequenz abgestimmt. Damit arbeiten wir mit einer Zwischenfrequenz von 0Hz. Wie geht das? Wir haben doch gerade gelernt, dass die Zwischenfrequenz für eine gute Selektion nicht zu niedrig sein darf. Betrachten wir mal, was bei den verschiedenen Modulationsarten im Direktmischer passiert.
Zweiseitenbandmodulation
Ein Rundfunksender auf beispielsweise 1 MHz belegt mit seinem oberen und unteren Seitenband die Frequenzen von 995,5 kHz bis 1004,5 kHz. Der Oszillator arbeitet beim Direktmischer auch auf der Trägerfrequenz von 1000 kHz. Die entstehende Summenfrequenz von 2 MHz wird unterdrückt. Die Differenz mit den Seitenbändern ergibt direkt die aufmodulierte Niederfrequenz. Dabei liegen jetzt die Frequenzen aus der Mischung mit dem oberen und unteren Seitenband übereinander. Da beide Seitenbänder die gleiche Information enthalten, ist das unproblematisch.
Das setzt allerdings voraus, dass Träger- und Oszillatorfrequenz genau übereinstimmen. Eine kleine Abweichung würde eine Frequenzverschiebung zwischen den Bändern ergeben und die NF wäre unverständlich. Außerdem entsteht aus der Differenz von Träger- und Oszillatorfrequenz ein Störton. Deshalb wird der Oszillator quasi auf die Trägerfrequenz "eingerastet". Man nennt diese Technik auch Synchrondemodulation.
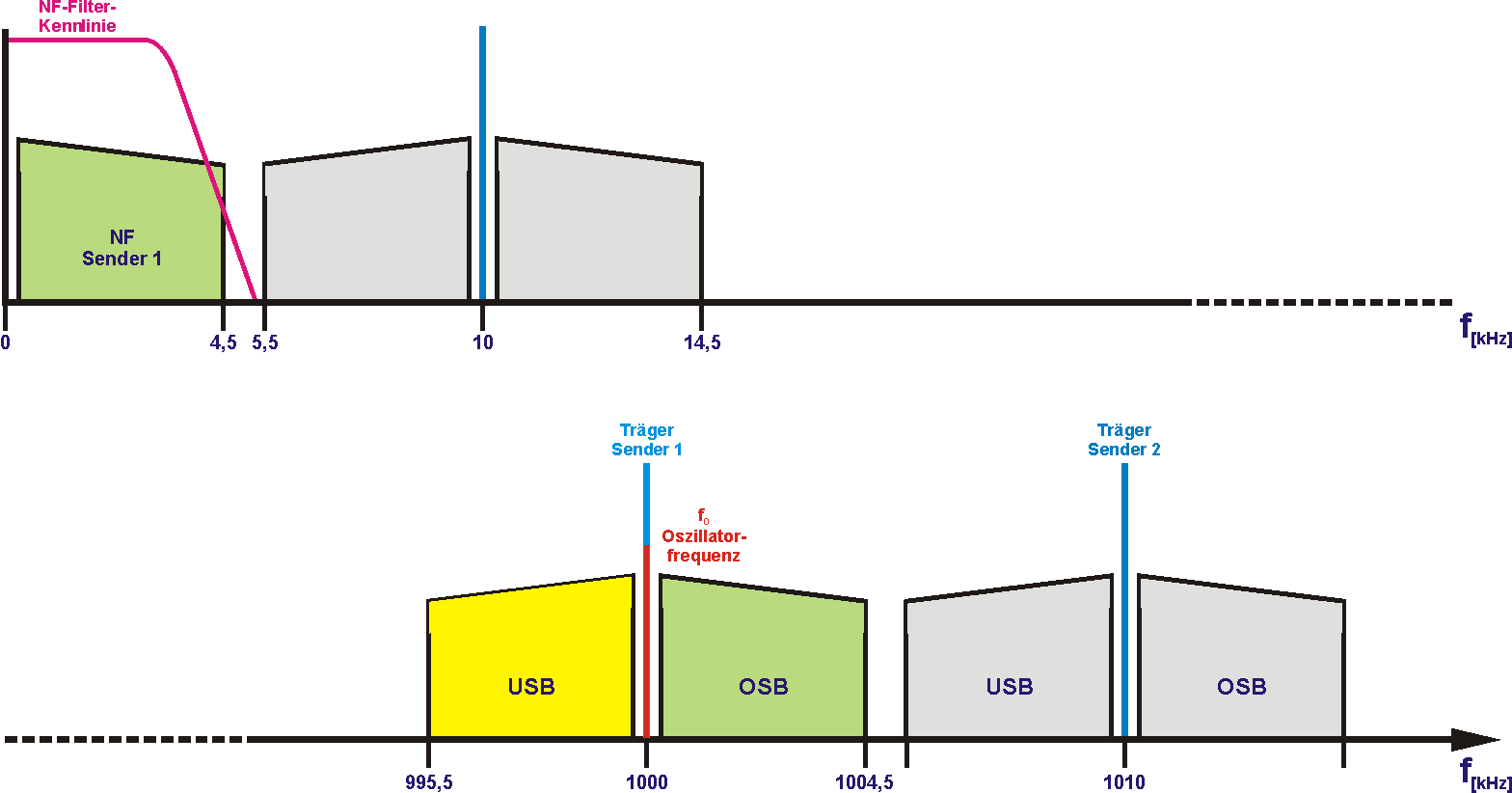
Ein zweiter Sender, nur 10 kHz weiter, wird vom Eingangsschwingkreis nicht ausreichend unterdrückt. Im Mischer entstehen hörbare Frequenzen zwischen 5,5 kHz und 15,5 kHz. Diese müssen jetzt durch ein steiles NF-Filter beseitigt werden, welches Frequenzen über 5 kHz ausfiltert.
Einseitenbandmodulation (SSB)
Bei der Einseitenbandmodulation fehlt der Träger und ein Seitenband. Der Träger wird beim Direktmischer durch die Oszillatorfrequenz ersetzt. Im Mischer entsteht wieder das NF-Signal. Wenn der Oszillator auf eine Frequenz auf der anderen Seite des Seitenbandes abgestimmt ist, entsteht aber ebenfalls ein NF-Frequenzband, allerdings mit umgekehrter Frequenzlage.
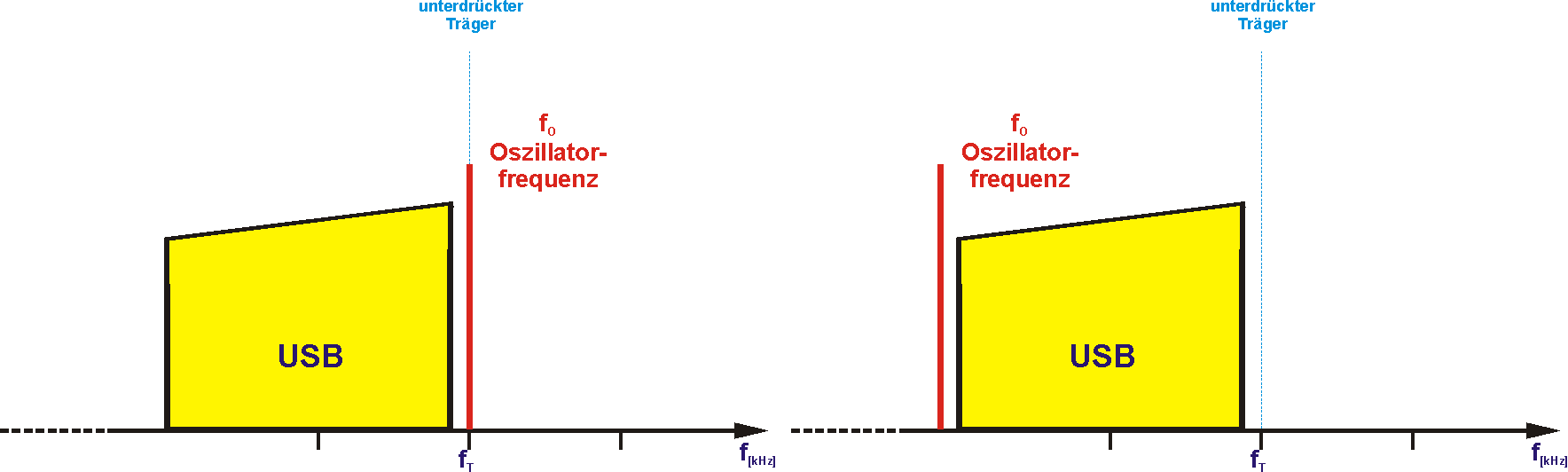
Jeder Sender erscheint also zweimal, aber nur einmal verständlich. Wirklich problematisch wird es, wenn ein anderer Sender im Bereich des fehlenden Seitenbandes strahlt. Es entsteht ein NF-Signal, welches das Nutzsignal überdeckt und sich nicht mit einem NF-Filter entfernen lässt. Um das Problem zu beseitigen, muss etwas mehr Aufwand getrieben werden, was den Hauptvorteil der Einfachheit des Direktmischer fast wieder zunichtemacht.
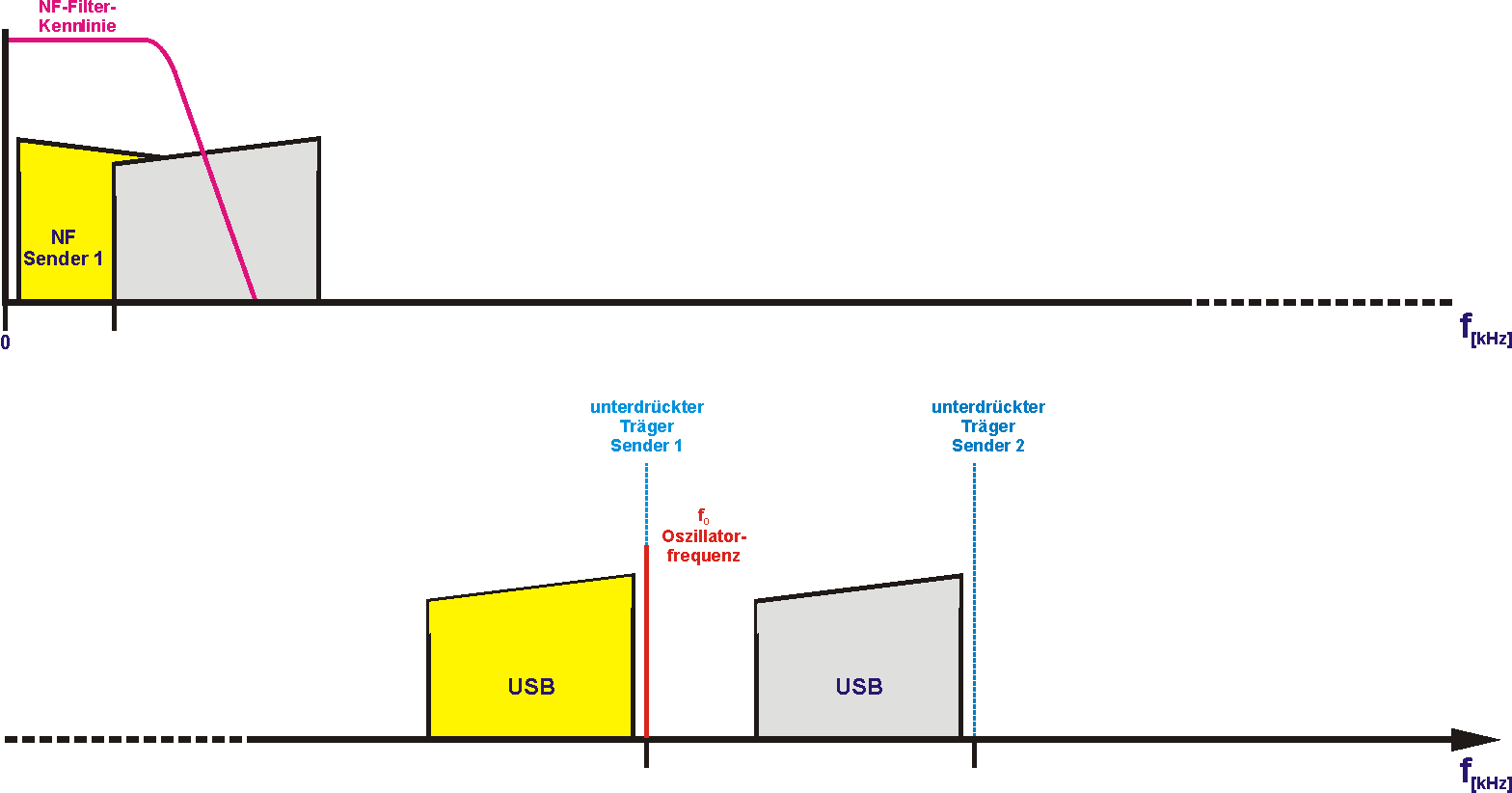
I & Q - Verfahren
Dieses Verfahren benötigt 2 Mischstufen, von denen eine die Oszillatorfrequenz um 90° phasenverschoben bekommt. Anschließend wird die Phase beim Ergebnis nochmals um 90° gedreht. Man hat jetzt 2 gegenphasige Mischsignale. Diese können nun voneinander subtrahiert oder addiert werden. Dadurch wird entweder das obere oder das untere Seitenband ausgelöscht, oder im Fall des Einseitenbandempfangs das Signal des benachbarten Senders. Es gibt keinen "Doppelempfang" mehr.
Die Phasendrehung ist aber frequenzabhängig und deshalb nur bei einer Frequenz wirklich 90°. Deshalb baut man 2 gleiche Phasenschieber mit ±45° in beide Kanäle ein. So bleibt die Phasendifferenz über den gesamten Frequenzbereich bei 90°.
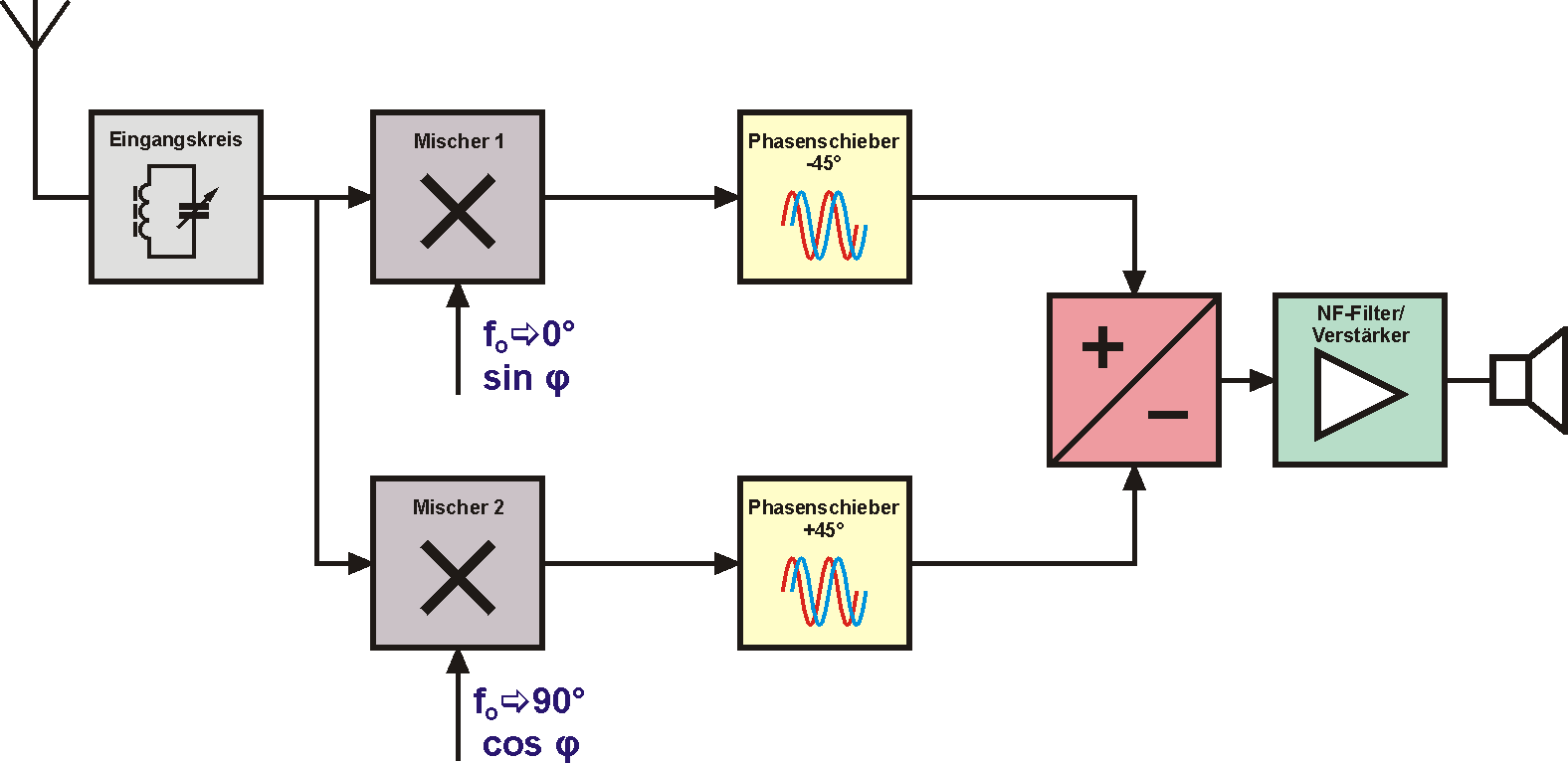
Da sich der Aufwand kaum noch von dem eines Superhets unterscheidet, setzte sich dieses Empfangskonzept nicht richtig durch. Es erlebt aber mit der digitalen Empfangstechnik gerade eine Wiederauferstehung. Der Empfänger ist sehr einfach und die Selektion und Demodulation erfolgt per Software. Unerwünschte Signalanteile werden einfach "herausgerechnet".